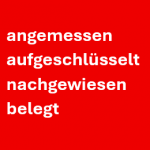(IRS) – Die kommissionelle Prüfung ist bestanden, der Eid ist im feierlichen Rahmen abgelegt, die amtlichen Papiere geben grünes Licht: Die Tätigkeit als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger kann beginnen! Damit einhergehend stellt sich die Frage: Nach welchem Stundentarif werde ich meine Leistungen abrechnen können? Welcher Tarif ist angemessen oder besser gesagt: Welche Höhe wird vom Gericht als angemessen akzeptiert? Bevor hier große theoretische Überlegungen angestellt werden, ist es wahrscheinlich hilfreicher, den eigenen Weg und die eigenen Erfahrungen zu schildern.
Ausgangspunkt Planung und Beratung
Vorauszuschicken ist: Meine jahrzehntelange Zeit als Planer und Berater in der Haus- und Energietechnik habe ich sehr genossen und geschätzt. Vor allem die Möglichkeit zu gestalterischer, kreativer und oft innovativer Herangehensweise setzten viel Begeisterung frei. Auch die Beziehungen zu Bauherrn, Planern anderer Technikbereiche und Professionisten waren fast immer gekennzeichnet von gegenseitigem Respekt und guter Zusammenarbeit. Warum ich dann meine Berufsweg immer stärker auf die Sachverständigentätigkeit ausgerichtet habe, hat einen einfachen Grund: Zwei größere Privatgutachten, deren Ergebnis dazu beigetragen hat, dass der Auftraggeber vor Gericht zu seinem Recht gekommen ist.
Die Anstöße zum Gerichtsgutachter
Die Erstellung der genannten Gutachten habe ich als sehr spannend empfunden, weil diese Aufgabe außerhalb der üblichen Routine lag. Zudem war anders als bei Planungsarbeiten bei Befund und Gutachten völlige Ergebnisoffenheit gegeben. Großes Gewicht hatte für mich auch die Äußerung des bestellten Gerichtsgutachters: Er erkannte in einem der Gerichtsfälle mein Privatgutachten als korrekt und übernahm es mit Zustimmung der Parteien als Grundlage für das Gerichtsverfahren. Damit war mir klar, dass eine Tätigkeit als Gerichtsgutachter durchaus möglich und erfolgversprechend wäre. Und nicht zuletzt waren auch die Höhen der lukrierten Stundentarife und damit Honorare ein positiver Impuls.
Genaue Aufschlüsselung und Belege
In einer Honorarnote (in richtigem Amts-Österreichisch gemäß Gebühren-Anspruchsgesetz nennt man das Honorar „Gebühr“ und die Honorarnote heißt dementsprechend „Gebührennote“, Anm.) für das Gericht muss der in Rechnung gestellte Arbeitsaufwand genau aufgeschlüsselt werden. Wichtigste Bestandteile der Honorarnote sind die Anzahl der benötigten Stunden und der zugehörige Stundentarif. Auf Anforderung des Gerichts (in der Praxis meist auf Verlangen des Rechtsanwalts der Partei, deren Unterliegen bereits absehbar scheint, Anm.) muss man in der Lage sein, beide Angaben penibel belegen zu können.
Tarife wie im außergerichtlichen Erwerbsleben
Der verrechnete Aufwand muss angemessen sein. Was In der gelebten Praxis bedeutet, dass der dem Gericht verrechnete Stundentarif nicht höher sein darf, als der in außergerichtlicher Tätigkeit erzielte. Dass diese Forderung eingehalten wurde, muss belegt werden können. Wie macht man das? Am besten, indem man – gegebenenfalls anonymisierte – Honorarnoten aus dem außergerichtlichen Erwerbsleben vorlegt. Was dann schwierig ist, wenn man bisher seine Leistungen pauschal abgerechnet hat und nicht nach Stundentarifen, wie dies für Planungsleistungen überwiegend der Fall ist. Darauf kommen wir später noch zu sprechen.
Man halte Nachweise für hohe Tarife stets bereit
In meinem Fall erwiesen sich die für die beiden erwähnten Privatgutachten angesetzten Stundentarife als gute und nützliche Starthilfe. In der Praxis wurden dann für wenig schwierige Gutachten und geringe Streitwerte natürlich geringere Stundentarife angesetzt. Aber es war immer beruhigend, bei entsprechenden Nachfragen recht locker darauf verweisen und gegebenenfalls belegen zu können, dass man ja ansonsten in seiner Arbeit doch höhere Tarife gewöhnt sei … Einem Rechtsanwalt, der sich darüber echauffierte, meine Stundensätze seien höher als die seinen, konterte ich, dass das wohl nicht mein Problem sei …
Gute Leistung hat ihren Preis
Wichtig war mir stets, dass das verrechnete Honorar durch die erbrachte Leistung – sprich durch gute Arbeit – gerechtfertigt war und dass der Auftraggeber mit dieser Leistung auch zufrieden war. Zu niedrige Vergütungen bringen dem Gutachter nicht nur wirtschaftliche Nachteile, sie rauben auch die Freude an der Arbeit. Auftraggeber, die unbedingt den Preis drücken wollen, sind zum Glück sehr selten, man kann sie auch ablehnen. Und wenn jemand mit dem Argument kommt, der „XY“ würd’s wesentlich billiger machen, dann soll er doch bitteschön den „XY“ damit beauftragen. Viel Spaß damit! Und zum Schluss eine Warnung: Nie sollte man in die Situation kommen, Aufträge um jeden Preis annehmen zu müssen!
(Wird fortgesetzt)
—